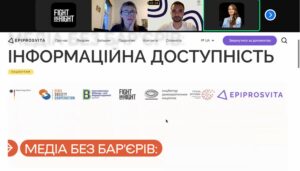Aktivisten und Aktivistinnen aus Ternopil, die im Projekt „Inklusion – einfach machen!“ einen von drei Prototypen zur Umsetzung der UN-BRK in der Ukraine entwickelt haben. Foto: privat
Mit Engagement und Ideen können Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Barrieren abbauen und die UN-Behindertenrechtskonvention in der Ukraine umsetzen. Drei konkrete Beispiele stellten die Sprecher:innen von drei Initiativen am Mittwoch, 18. Dezember 2024, im Online-Meeting zum Abschluss des deutsch-ukrainischen Projekts „Inklusion – einfach machen!“ vor. Nachahmung erwünscht!
Constanze Stoll, Referentin der IBB gGmbH Dortmund, begrüßte zum Abschluss des nur sechs Monate dauernden Projekts mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Ukraine und Deutschland. Der Projekttitel „Inklusion – einfach machen!“ habe in der deutschen Sprache eine doppelte Bedeutung: Zum einen solle Inklusion einfach gemacht werden im Sinne einer Vereinfachung für alle Beteiligten, so dass Barrieren wirklich abgebaut werden. Zum anderen bedeute „einfach machen“ auch, nicht auf irgendetwas zu warten, sondern aktiv und mutig die Initiative für die Erprobung von Barrierefreiheit und gelebter Inklusion zu ergreifen.
Auf der Zukunftskonferenz in Lwiw vom 1. bis 4. Oktober 2024 hatten die Teilnehmenden Defizite beschrieben und Vorschläge für Verbesserungen entwickelt. Was in überschaubaren Zeiteinheiten entstehen kann, um die UN-Behindertenrechtskonvention trotz der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine umzusetzen, zeigten die drei bearbeiteten Ideen, die erst Anfang November aus sechs eingereichten Ideenskizzen ausgewählt worden waren.
- Für den Bereich Medien & Kommunikation: Ein Prototyp für einfache Sprache, speziell für Journalist:innen in Lwiw
- Für den Bereich Soziales & Arbeitsmarkt: Ein Prototyp zur Ausbildung von gehörlosen Stadtführer:innen in vier Städten
- Für den Bereich Bildung & Kultur: Ein Prototyp zur Analyse von Barrieren in zwei Kulturinstitutionen in der Region Ternopil.
Die entwickelten Lösungsvorschläge zum Abbau von Barrieren und der Erweiterung von Teilhabe und Teilgabe wurden als Prototypen bezeichnet. Der Begriff unterstreicht die Absicht, Ideen schnell und aktionsorientiert in beispielhaften Modellen zu realisieren, um Inklusion, Teilhabe und Teilgabe praktisch umzusetzen und mit den Modellen zu lernen: Was funktioniert in dem Modell gut? Was funktioniert noch nicht? An welchen Stellen müssen wir noch andere Expertise einholen? Welche Fragen müssen wir stellen, um weitere Barrieren zu verringern? Gemäß dem Motto: Fail early, to learn quickly! Entstanden sind:
-
Ein Booklet mit Empfehlungen zur barrierearmen Textarbeit für Medienschaffende
Maryna Stashyna-Neimet präsentierte das Ergebnis für den Bereich Medien und Kommunikation. Die gemeinnützige Organisation „Zivilholding‚ Gruppe Einfluss‘“ aus Lwiw hat ein zweiteiliges Trainingsseminar für Journalistinnen und Journalisten zu barrierefreien Inhalten entwickelt.
Vorgehen: Zehn Journalist:innen nahmen an einer eintägigen Veranstaltung in Lwiw teil. In einem späteren Online-Meeting experimentierten sie mit ihren neuen Kenntnissen. Sie verfassten kleine Texte und übten sich in der Bildbeschreibung. Maryna Stashyna-Neimet, die selbst mit einer Sehbeeinträchtigung lebt und als Trainerin ihr Wissen an die Medienleute weitergab, fasste zusammen: Print- und Onlinemedien sollten zum Beispiel Fachbegriffe vermeiden, häufiger die Alltagssprache verwenden und Bilder so beschreiben, so dass sie von Screen-Readern ausgelesen und von den Adressierten verstanden werden können.
Ergebnis & Perspektive: Alle Empfehlungen sind nun in einer Handreichung für Medienschaffende zusammengefasst, die für Medien ohne Barrieren sensibilisiert. Das Booklet wurde bereits an 600 Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine verteilt.
„Wir müssen Standards erarbeiten und Normen setzen“, sagte Niia Nikel, die mit ihrer Organisation Epiprosvita die Umsetzung dieses Projekts unterstützt hatte. Das nächste Ziel sei es, barrierefreie Medienarbeit in die Ausbildung von Journalisten und Journalistinnen zu integrieren. Aktuell gebe es eine große Offenheit für das Thema.
„Ich glaube, es gibt keinen Menschen in der Ukraine, der nicht jemanden mit einer Behinderung kennt.“
Das Bewusstsein sei groß, dass verständliche Informationen besonders in der aktuellen Situation lebenswichtig sein können. „Taube hören Explosionen und entsprechende Warnhinweise nicht!“
Das Booklet zur barrierearmen Medienarbeit finden Sie zum Download hier (in ukrainischer Sprache).
-
Ausbildung von gehörlosen Städtetour-Guides
Die Gemeinnützige Organisation „Bildungshilfe“ in Chmelnyzkyj hat die Ausbildung von Städtetour-Guides mit Hörbehinderungen als Prototyp entwickelt. Der Bedarf in der Ukraine ist groß, denn mehr als 30.000 Menschen hören nicht oder nur eingeschränkt. Dennoch werden sie von den gegenwärtigen Angeboten der Tourismusbranche nicht als Publikum berücksichtigt.
Vorgehen: In Zusammenarbeit mit der Universität in Chmelnyzkyj durchliefen vier taube Gebärdensprach- Expert:innen die zertifizierte Weiterbildung zum Städtetour-Guide, die für sie in Gebärdensprache übertragen wurde. Mit dem in der Ukraine bekannten und erfahrenen deutsch-ukrainischen Städtetour-Guide Erwin Miden aus Chernihiw konnte das Team in einem mehrstündigen Online-Meeting Fragen der Freiberuflichkeit, der Akquise und Fragen des Images als Guide und zur Rolle der eigenen Persönlichkeit diskutieren.
Das begehrte Zertifikat als Städtetour-Guide erhalten nur Personen, die die Weiterbildung an der Universität erfolgreich absolviert und eine zweistündige Stadttour fachkundig geleitet haben. Teil der Weiterbildung für die vier Zertifikats-Anwärter:innen war also die öffentlichkeitswirksame Akquise von Tourgästen in ihren vier Wohnorten Lwiw, Kyjiw, Kriwoj Rih und Chmelnyzkyj für die in diesem Fall kostenlosen Führungen. Die Gäste testeten die Stadtführung für Taube, Hörbehinderte und Hörende. Die Resonanz überraschte selbst die Macher:
„Taube erzählen viel besser“,
zitierte Olga Burlaka die begeisterte Einschätzung vieler tauber Teilnehmender. Hörbehinderte hätten sehr emotional auf die Stadtführung in ihrer eigenen Sprache, der Gebärdensprache, durch taube Guides reagiert und das Angebot begeistert angenommen.
Ergebnis & Perspektive: Die vier Gebärdensprach-Expert:innen haben detaillierte Konzepte für Städtetouren entwickelt, die sie nun weiter ausbauen und als kulturelles Angebot vermarkten möchten. Der Testlauf hat eindrucksvoll gezeigt, dass die Nachfrage unter tauben Menschen enorm ist. Auf Basis einer genaueren Analyse der Zielgruppe können die Touren künftig gezielt angepasst und variiert werden. Die Guides planen, ihr Repertoire kontinuierlich zu erweitern. Eine zentrale Frage wird dabei sein, wie das kulturelle Angebot der tauben Städte-Tourguides preislich gestaltet werden kann und welche finanziellen Fördermöglichkeiten in Zusammenarbeit mit den Städten realisiert werden könnten.
Potenzial sehen die Aktivist:innen darin, noch mehr Hörende für das Angebot zu gewinnen. Im ersten Durchlauf seien mehr taube Menschen als hörende erreicht worden. „Denkbar und wünschenswert ist aus unserer Sicht, dass taube und hörende Menschen gemeinsam an den gebärdensprachlichen Städtetouren teilnehmen“, fasste Olga Burlaka die Nachbetrachtungen des Teams zusammen. So könne daran gearbeitet werden, die Übersetzung aus der Gebärden- in die Lautsprache zu verbessern.
„Wir wollen auch Hörenden die Gebärdensprachkultur näherbringen und möchten die gewonnenen Erfahrungen gern ausbauen und weitergeben“,
erzählte Olga Burlaka. Denn inklusive Stadtführungen von Tauben könnten Arbeitsplätze in der Tourismusbranche in allen Regionen schaffen und auch in Chmelnyzkyj zum dauerhaften Angebot werden.
Die Power-Point-Präsentation des Teams finden Sie hier (in ukrainischer Sprache).
-
Analyse von Barrieren ìn Kultureinrichtungen in der Region Ternopil
Die gemeinnützige Organisation „Ich kann“ aus Ternopil hat zwei zentrale Kultureinrichtungen der Region auf ihre Barrierefreiheit hin untersucht und Verbesserungsvorschläge entwickelt: Den Wyschniwezker Palast und das Heimatkundemuseum Ternopil.
Vorgehen: Zum Team gehörten Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, einige Assistenzpersonen und Angehörige. Gemeinsam prüften sie die Einrichtungen mit einem eigens entwickelten Fragebogen, der die Bedarfe von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und Hörbeeinträchtigungen berücksichtigt. Das Ergebnis: Hohe Stufen, zu steile Rampen, Stolperfallen sowie sprachlich komplexe Texte erschweren Menschen mit körperlichen und Sinnesbeeinträchtigungen den Zugang.
„Wir müssen echte Pionierarbeit leisten!“,
erklärte Taras Khomickyj bei der Vorstellung des dritten Projektergebnis.
Ergebnis & Perspektive: Der Prototyp, dessen Kern die praktische Teilhabe und Teilgabe beim Abbau von Barrieren in Kultureinrichtungen von behinderten Menschen ist, hat bereits jetzt zu einer Nachfrage bei anderen Kultureinrichtungen der Region geführt: Sie wünschen sich ebenfalls eine Testung ihrer Angebote und pragmatische Anregungen für mehr Barrierefreiheit. Der erarbeitete Fragenkatalog zur Untersuchung der Barrierefreiheit – auch das hat die Testung gezeigt – kann und muss auf andere Bedarfe, wie beispielsweise von Menschen mit einer Lernbehinderung erweitert werden. Das Team wird weitere Kooperationsangebote schaffen und verstärkt auf den Dialog zur Umsetzung der UN-BRK im Handlungsfeld von Bildung und Kultur setzen.
Die Power-Point-Präsentation des Teams finden Sie hier (in ukrainischer Sprache).
„Vor der Konferenz in Lwiw wussten wir nicht, dass Menschen mit Behinderungen so unterschiedliche Bedürfnisse haben“,
schilderte Iwan Kosmina eine wichtige Erfahrung aus der barrierefrei organisierten Zukunftskonferenz vom 1. bis 4. Oktober 2024 in Lwiw. Bei allen Beteiligten sei der Wunsch entstanden, in der ukrainischen Gesellschaft den Zusammenhang zwischen Demokratie und Inklusion als Menschenrecht stärker in den Fokus ihrer Arbeit zu rücken und aktiv Verantwortung für mehr Teilhabe zu übernehmen.
 Nazarii Boyarskyi von der Partnerorganisation „Inkubator für demokratische Initiativen“ äußerte den Wunsch und die Hoffnung, dass die erarbeiteten Materialien und Medien genutzt werden auch vom deutschen Publikum.
Nazarii Boyarskyi von der Partnerorganisation „Inkubator für demokratische Initiativen“ äußerte den Wunsch und die Hoffnung, dass die erarbeiteten Materialien und Medien genutzt werden auch vom deutschen Publikum.
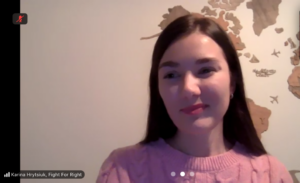 Karina Hrytsiuk von der Organisation „Fight for Right“ betonte, die Arbeit an den Prototypen habe gezeigt, dass die Losung „Nicht über uns ohne uns!“ bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bedeutet, Menschen mit Behinderung nicht als Abnehmer inklusiver Lösungen zu denken, sondern sie aktiv in die Prozesse miteinzubeziehen.
Karina Hrytsiuk von der Organisation „Fight for Right“ betonte, die Arbeit an den Prototypen habe gezeigt, dass die Losung „Nicht über uns ohne uns!“ bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bedeutet, Menschen mit Behinderung nicht als Abnehmer inklusiver Lösungen zu denken, sondern sie aktiv in die Prozesse miteinzubeziehen.
Constanze Stoll hob abschließend das hohe Engagement aller Beteiligten hervor und bedankte sich für die intensive Mitarbeit. „Alle drei Prototypen haben gezeigt, dass das Arbeiten mit diesem Ansatz sich besonders für Inklusion eignet: Prototypen ermöglichen nutzerzentrierte und praxisnahe Lösungen. Barrieren können schrittweise identifiziert und in realen Kontexten getestet werden, während der Dialog zwischen Betroffenen und Fachleuten aktiv gefördert wird. Durch sichtbare Fortschritte entstehen zudem Motivation und Bewusstsein für nachhaltige Veränderungen.“
Das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk gGmbH hofft aktuell auf die Bewilligung eines Anschlussprojekts.
Das Projekt „Inklusion – einfach machen!“ wurde organisiert vom Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk gGmbH in Kooperation mit der NRO „Inkubator demokratischer Initiativen“ (Ukraine) und der NRO „Fight for Right“ (Ukraine). Gefördert wurde das Projekt durch Mittel des Auswärtigen Amtes aus dem Programm „Ausbau der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen Partnerschaft“.
#civilsocietycooperation
Das Beitragsbild (oben) zeigt das inklusive Team in Ternopil. Alle Fotos: privat
Weitere Informationen über dieses Projekt finden Sie auch hier:
„Inklusion – einfach machen!“: Prototypen sollen im Dezember vorgestellt werden
Kickoff-Meeting zum neuen Projekt „Inklusion – einfach machen“.